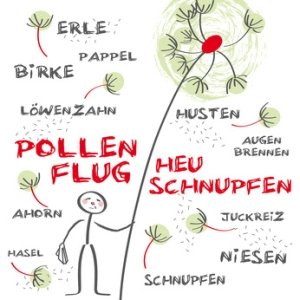Biologika bei Asthma, Neurodermitis, Urtikaria, Nasenpolypen

Bei bestimmten chronischen Erkrankungen kann ein größerer Behandlungserfolg erzielt werden, indem gezielt in die immunologischen Prozesse des Körpers eingegriffen wird. Eine Medikamentengruppe, mit der das geschieht, wird Biologika genannt. Biologika sind Proteine, die rekombinant, d.h. gentechnisch, hergestellt werden. Meistens handelt es sich dabei um Antikörper. Die Herstellung ist aufwendig und teuer. Die Haupteinsatzgebiete von Biologika sind Erkrankungen mit autoimmuner Beteiligung, aber auch im Rahmen der Krebstherapie und nach Organtransplantation kommen Biologika zum Einsatz. Sind Biologika auch bei Allergien eine sinnvolle Therapieoption? Was ist verfügbar für die Behandlung von Asthma, Neurodermitis, Nasenpolypen, Urtikaria und Angioödemen?
Autoren:
Dr. med. Anna Eger, Prof. Dr. med. Margitta Worm, PD Dr. med. Sabine Altrichter, Prof. Dr. med. Martin Wagenmann, Prof. Dr. med. Christian Taube, Prof. Dr. med. Thomas Werfel
Biologika: Was ist das? Wie funktionieren sie?
Biologika sind Arzneistoffe, die mit Hilfe moderner Verfahren der Biotechnologie aufwendig hergestellt werden und direkt in die menschliche Immunantwort eingreifen. Biologika binden dabei an spezifische Strukturen, die bei der Immunantwort eine Rolle spielen. Bei Kenntnis der immunologischen Prozesse können sie daher ganz gezielt an bestimmte Immunmechanismen ansetzen. Meistens handelt es sich bei Biologika um Antikörper. Es können aber auch Proteine sein, welche an eine andere Struktur binden können. Auf diese Art und Weise wird die Immunantwort des Körpers reduziert, was neben dem gewünschten Effekt auf die entsprechende Erkrankung natürlich auch mit dem Risiko einer erhöhten Infektanfälligkeit einhergeht.
Wie wirken Biologika?
Beim Einsatz zur Immunsuppression richten sich die Biologika gegen ein spezifisches Protein der Immunkaskade. Sie binden daran und schalten sie damit aus. Beispiele für Ziel-Proteine sind TNF-alpha, alpha-4-Integrin, IgE, die alpha-Kette des IL-2-Rezeptors, CD20 oder CD52, VEGF, EGFR, Interleukin-1 und viele weitere. Die meisten Biologika sind Antikörper, was die Silbe „mab“ für „monoclonal antibody“, also „monoklonaler Antikörper“ widerspiegelt. Nur wenige sind Proteine mit Bindungsfunktion, wofür z.B. die Silbe „cept“ im Medikamentenname steht.
Für welche Erkrankungen setzt man Biologika schon lange ein?
Biologika haben vor allem bei der Behandlung autoimmuner Erkrankungen einen hohen Stellenwert. Bei Erkrankungen des rheumatischen Formenkreises wie die Rheumatoide Arthritis, die Spondylitis ankylosans (Morbus Bechterew) oder die Psoriasis-Arthritis kommen sie ebenso zum Einsatz wie bei anderen chronisch-entzündlichen Systemerkrankungen, z.B. Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa. Auch bei der Multiplen Sklerose findet die Biologika-Therapie ihre Anwendung. Ein weiteres großes Einsatzgebiet sind Tumorerkrankungen, wie das B-Zell-Non-Hodgkin-Lymphom oder die chronisch-lymphatische Leukämie (bei letzterer allerdings off-label). Auch bei bestimmen Formen des Mamma- oder Magen-Karzinoms oder auch im Rahmen anderer zytostatischer Therapien zum Beispiel beim Kolonkarzinom, Ovarialkarzinom oder Nierenzellkarzinom u.a. werden Biologika eingesetzt. In der Augenheilkunde kommt es intravitreal bei der altersbedingten Makuladegeneration zur Anwendung. Ein wichtiger Therapiebestandteil sind Biologika in der Transplantationsmedizin. Schließlich gibt es auch für schweres Asthma bronchiale, Neurodermitis, Nasenpolypen und Urtikaria/Angioödeme Therapieoptionen mit Biologika.
Welche Biologika gibt es bereits?
In der Therapie der Rheumatoiden Arthritis kommen beispielsweise Infliximab, Adalimumab und Etanercept zum Einsatz. Die genannten drei Wirkstoffe sind sogenannte TNF-alpha-Blocker und kommen auch bei der Psoriasis-Arthritis, dem Morbus Bechterew und den chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa zum Einsatz. Für Etanercept wurde für Mb. Crohn und Colitis ulcerosa jedoch keine Wirksamkeit nachgewiesen, sodass es für diese beiden Erkrankungen nicht zugelassen ist. Adalimumab ist auch für die Behandlung der Akne inversa zugelassen.
Rituximab ist ein häufig in der Krebstherapie bspw. zur Behandlung des B-Zell-NHL verwendeter Antikörper. Er richtet sich gegen das spezifische Oberflächenprotein CD20 auf B-Lymphozyten.
Alemtuzumab ist ein sich gegen das Oberflächenprotein CD52 richtender Antikörper, der off-label bei der Therapie der chronisch-lymphatischen Leukämie und als Eskalationstherapie bei der Multiplen Sklerose angewendet werden kann. Als weiteres Biologikum in der Behandlung der MS gibt es Natalizumab, welches sich gegen alpha-4-Integrin richtet.
In der Transplantationsmedizin kommen beispielsweise Muromonab-CD3 und Basiliximab zum Einsatz, um Abstoßungsreaktionen zu therapieren bzw. vorzubeugen.
Belimumab ist ein Biologikum, das erfolgreich in der Behandlung des systemischen Lupus erythematodes eingesetzt wird.
Im Rahmen der Krebstherapie verschiedener solider Tumore (Darm, Brust, Lunge, Eierstock, Niere, Gebärmutterhals, Haut etc.) spielen unter Umständen die Antikörper Trastuzumab (Antikörper gegen den Rezeptor HER2/neu), Bevacizumab (Antikörper gegen den Wachstumsfaktor VEGF) und Cetuximab (Antikörper gegen den Wachstumsfaktorrezeptor EGFR) eine Rolle.
Bei welchen allergischen Erkrankungen können Biologika helfen?
Biologika kommen bereits seit einigen Jahren bei einigen allergisch bedingten Erkrankungen zum Einsatz. Gleichzeitig laufen hierzu zahlreiche Studien.
Biologika zur Therapie von Asthma bronchiale
Die Asthmatherapie ist eine Stufentherapie. Erst ab Stufe 5 (schweres Asthma) kann die Indikation zu einer Behandlung mit Biologika gestellt werden, wenn selbst nach dreimonatiger maximaler inhalativer Kombinationstherapie in Dreierkombination keine Asthmakontrolle erreicht werden kann. Die Indikation hierfür muss ein erfahrener Pulmologe stellen. Für Omalizumab wird unter bestimmten Umständen ein mindestens viermonatiger Therapieversuch empfohlen, u.a. bei einem schweren IgE-vermittelten allergischen Asthma. Es gibt weitere Empfehlungen zu einem Therapieversuch unter gewissen Voraussetzungen mit Mepolizumab, Reslizumab oder Benralizumab, z.B. bei einem schweren eosinophilen Asthma. Desweiteren steht Dupilumab zur Verfügung, wenn bestimmte Kriterien vorliegen. Die Wirksamkeit der monoklonalen Antikörper muss nach vier und zwölf Monaten, dann in jährlichem Abstand kontrolliert werden. Unter engmaschiger Kontrolle kann die zuvor bestehende Langzeittherapie im Verlauf nach eindeutiger klinischer Besserung reduziert werden.
Welchen Asthma-Patienten können Biologika helfen?
Eine wichtige Voraussetzung für die Entscheidung für oder gegen den Einsatz von Biologika zur Asthma-Therapie ist die Unterscheidung zwischen einem „schweren Asthma“ und einem „schwierigen Asthma“. Dies betonte Prof. Dr. med. Christian Taube, Direktor der Klinik für Pneumologie an der Universitätsmedizin Essen – Ruhrlandklinik, im Rahmen der DGAKI-Fachkonferenz zu „Biologika“*. Ist auch nur eine dieser Voraussetzungen nicht gegeben, handelt es sich um ein schwieriges Asthma, bei dem die Symptome durch das Optimieren der Therapie kontrolliert werden können. Ein weiterer Indikator für eine erfolgversprechende Asthma-Therapie mit Biologika ist das Vorliegen einer chronischen Inflammation einer sogenannten Typ-2-Entzündung. „Ob eine solche Typ-2-Inflammation vorliegt, kann anhand von Messungen der Eosinophilen im Blut oder im Sputum und durch eine FeNO-Messung nachgewiesen werden“, erklärte Prof. Taube.
Wann ist es ein „schweres Asthma“, wann ein „schwieriges Asthma“
Um ein „schweres Asthma“ handelt es sich, wenn die folgenden Voraussetzungen gegeben sind, wie Prof. Taube erklärt:
- Die Diagnose Asthma“ ist korrekt gestellt
- Die Inhalationstechnik wird vom Patienten korrekt ausgeführt
- Die Inhalation erfolgt regelmäßig, wie verordnet
- Die Dosierung der Asthma-Medikamente ist optimal eingestellt
- Potenzielle Asthma-Trigger wurden ausgeschaltet
- Bestehende Komorbiditäten wurden erkannt und werden behandelt
Kortison-Reduktion durch Biologika
Gerade Patienten, deren Asthma-Symptome schwer zu kontrollieren sind, werden häufig mit oralen Kortikosteroiden behandelt. „Untersuchungen haben gezeigt, dass die Patienten durch eine dauerhafte Biologika-Therapie ihren Kortison-Bedarf deutlich senken konnten bzw. von oralem auf inhalatives Kortison umsteigen konnten“, so Prof. Taube. Auch konnten Studien zeigen, dass sich die Anzahl der Exazerbationen, die Lungenfunktion und die Lebensqualität ganz allgemein durch die Therapie mit Biologika verbessern.
Aktuell stehen die folgenden Biologika zur Behandlung bei Asthma zur Verfügung:
- Dupilumab
- Benralizumab
- Omalizumab
- Reslizumab
- Mepolizumab
- Tezepelumab
„Dabei ist es wichtig, das richtige Medikament für den richtigen Patienten auszuwählen“, entsprechende Marker stehen zur Verfügung“, so Prof. Taube.
*“Asthma bronchiale“, Prof. Dr. med. Christian Taube, Allergieakademie der DGAKI, Allergie im Fokus „Biologika“ 13. und 14. Januar 2023
Biologika zur Therapie von Neurodermitis
Auch bei der Neurodermitis gibt es eine Stufentherapie. Je nach Leitlinie wird die schwerste Stufe als 4 mit persistierenden, schwer ausgeprägten Ekzemen, die trotz verschiedener nichtmedikamentöser und topischer medikamentöser Maßnahmen nicht therapierbar ist bezeichnet oder zusammen mit moderaten Formen als Stufe 3 zusammengefasst. In dieser Stufe ist eine systemische immunmodulatorische Therapie zu erwägen, wenn topische Therapien alleine nicht ausreichend wirksam sind. Hierfür gibt es verschiedene Studien und Therapieansätze. 2017 wurde in Deutschland beispielsweise das Biologikum Dupilumab für die Behandlung mittelschwer bis schwer ausgeprägter Neurodermitis zugelassen. Des Weiteren gibt es eine andere Wirkstoffgruppe, die sogenannten Januskinase-Inhibitoren, kurz JAK-Inhibitoren (oder JAKi), von denen 2020 und 2021 die ersten beiden Wirkstoffe für Neurodermitispatienten zugelassen wurden. JAKi modulieren verschiedene Zytokine, die bei der Neurodermitis eine Rolle spielen.
Systemische Neurodermitis-Therapie mit den Biologika Dupilumab und Tralokinumab
Wie Professor Dr. med. Thomas Werfel, Direktor der Klinik für Dermatologie, Allergologie und Venerologie, Medizinische Hochschule Hannover bei der DGAKI-Fachkonferenz zu Biologika** feststellt, sind die Erfahrungen mit der Wirksamkeit der beiden zurzeit für die Neurodermitis zur Verfügung stehenden Biologika gut. Sowohl Dupilumab, ein Anti IL-4- und Anti IL-13-Rezeptor, als auch Tralokinumab, ein Anti IL-13-Rezeptor, reduzieren die Ekzeme unter Dauertherapie deutlich und anhaltend. Bei Dupilumab, das alle zwei Wochen verabreicht werden muss, kommt hinzu, dass das Medikament auch bei Asthma bronchiale, Nasenpolypen (CRSwNP) und Eosinophiler Ösophagitis (EoE) wirksam und zugelassen ist. Auch das Biologikum Tralokinumab wird subkutan verabreicht. „Bei Tralokinumab liegt es im Ermessen des Arztes, ob das Medikament in der Erhaltungsdosis alle zwei oder alle vier Wochen angewendet werden soll“, erläutert Prof. Werfel. „Bei der Wirksamkeit spielt es sicher auch eine Rolle, dass die Patienten Biologika in der Regel h sehr gewissenhaft zur Selbstinjektion anwenden“, erklärt Prof. Werfel.
Systemische Neurodermitis-Therapie mit Januskinase-Inhibitoren (JAKi)
Relative neu sind die Neurodermitis-Therapien mit Januskinase-Inhibitoren, die oral angewendet werden. Zur Verfügung stehen hierfür aktuell die Substanzen Baricitinib, Upadacitinib und Abrocitinib. Januskinase-Inhibitoren wirken schneller als Biologika, wobei sich die Wirksamkeit im Behandlungsverlauf angleicht. Zudem wirken die JAKi auch auf Erkrankungen, die mit der atopischen Dermatitis assoziiert sind, zum Beispiel Alopezia areata und Vitiligo, eine Zulassung für die Behandlung der Alopezia areata liegt derzeit allerdings nur für Baricitinib vor Zugelassen sind Januskinase-Inhibitoren außerdem auch für rheumatologische Indikationen (Baricitinib und Upadacitinib) und für Colitis ulcerosa (Upadacitinib). „Zu beachten ist allerdings, dass JAKi bei Patienten, bei denen bestimmte Risikofaktoren bestehen, nur unter bestimmten Bedingungen eingesetzt werden sollten“, ergänzt Prof. Werfel.
| Systemtherapeutika bei chronischer moderater oder schwerer Neurodermitis | |||
| Wirkstoff | Klasse | Status | Alter |
| Dupilumab | Biologikum | zugelassen | ab 6 Monaten |
| Tralokinumab | Biologikum | zugelassen | ab 12 Jahren |
| Baricitinib | Januskinase-Inhibitor | zugelassen | ab 18 Jahren |
| Upadacitinib | Januskinase-Inhibitor | zugelassen | ab 12 Jahren |
| Abrocitinib | Januskinase-Inhibitor | zugelassen | ab 18 Jahren |
| Quelle: Prof. Dr. med. Thomas Werfel, www.mein-allergie-portal.com | |||
Systemische Neurodermitis-Therapien: Woran wird geforscht?
Zahlreiche Unternehmen forschen aktuell an weiteren Konzepten zu Behandlung der atopischen Dermatitis.
Zudem gibt es Substanzen, die in anderen Ländern bereits für die Neurodermitis-Therapie zugelassen sin, wie:
- Ruxolitinib, ein JAK1/JAK2-Inhibitor, zugelassen in den USA. Das Zulassungsverfahren in der EU läuft, Zulassung derzeit inder EU für die Vitiligo vor
- Delgocitinib, ein Pan JAK, zugelassen als Salbe in Japan
- Crisaborol, gerichtet gegen das Zielmolekül PDE4, zugelassen in USA
Es bleibt abzuwarten, ob und wann diese Substanzen zur Therapie der atopischen Dermatitis auch in der EU verfügbar sein werden. „Generell ist die potenzielle Vielfalt der Behandlungsmöglichkeiten aber eine erfreuliche Entwicklung“, schließt Prof. Werfel.
| Therapeutische Antikörper bei AD: Was ist in der Pipeline? (Auswahl) Bieber, Nat Rev Drug Discov.) | ||
| Wirkstoff | Wirkmechanismus | Studienphase |
| Lebrikizumab | Anti-IL-13 mAb | Phase 3 |
| Nemolizumab | Anti-IL-31RA mAb | Phase 3 |
| GBR830 | Anti-OX40 mAb | Phase 2 |
| KY1005 | Anti-OX40 mAb | Phase 2 |
| Tezepelumab | Anti-TSLP mAb | Phase 2 |
| ANB020/Etokimab | Anti-IL-33 | Phase 2 |
| PF-06817024 | Anti-IL-33 | Phase 1 |
| Fezakinumab | Anti-IL-22 mAb | Phase 2 |
| Bermekimab | Anti-IL-1α mAb | Phase 2 |
| Quelle: Prof. Dr. med. Thomas Werfel, www.mein-allergie-portal.com | ||
**Prof. Dr. med. Thomas Werfel, “Atopische Dermatitis“, Allergieakademie der DGAKI, Allergie im Fokus „Biologika“ 13. und 14. Januar 2023
Biologika zur Therapie von Urtikaria und Angioödemen
Für einige Patienten mit chronischer Urtikaria und Angioödemen ist die Therapie mit nicht-sedierenden Antihistaminika laut Leitlinie nicht ausreichend. Diese Patienten profitieren von dem bereits zum Einsatz kommenden monoklonalen Antikörper gegen IgE, Omalizumab. Allerdings sind auch hier die Therapieergebnisse nicht für alle Patienten zufriedenstellend. Es gibt deshalb in diesem Gebiet Forschungen, die sich mit der Entwicklung und dem Einsatz weitere Biologika als mögliche Therapieoption befassen. Für eine andere, seltene Form des Angioödems, das hereditäre Angioödem (HAE), ist eine neue Substanz, Lanadelumab, ein Antikörper der gegen Plasma-Kallikrein gerichtet ist, zur Behandlung zugelassen.
Lanadelumab und Berotralstat zur vorbeugenden Behandlung des Hereditären Angioödems
Wie PD Dr. med. Sabine Altrichter, Oberärztin in der Abteilung Dermatologie und Venerologie, Kepler Universitätsklinikum, Linz, im Rahmen der DGAKI-Fachkreiseveranstaltung zu Biologika berichtet***, wird Lanadelumab, ein Antikörper gegen Plasmakallikrein, vorbeugend zur Prophylaxe gegen HAE eingesetzt und subkutan angewendet. Eine weitere neue Substanz, das die Attacken beim hereditären Angioödem verhindern soll, ist Berotralstat. „Das synthetische Molekül, ein sogenanntes „Small Molecule“ ist ebenfals ein Kallikrein-Inhibitor und wird als Kapsel täglich eingenommen“ so PD Altrichter, „dabei erhöht sich die Wirksamkeit des Medikamentes mit der Dauer der Einnahme“. Auch für das ebenso seltene erworbene Angioödem zeigte sich in Case Studies eine Wirksamkeit von Lanadelumab.
Omalizumab, Dupilumab, Fenebrutinib, Reminbrutinib: Neue Therapieansätze bei chronisch spontaner Urtikaria
Zur Therapie der chronischen Urtikaria und der damit einhergehenden Angioödeme wird Omalizumab bereits seit vielen Jahren eingesetzt. „Neu ist die Empfehlung der Urtikaria-Leitlinie, das Biologikum bei Bedarf auch in erhöhter Dosierung oder mit einem verkürzten Intervall einzusetzen, allerdings off-label“ betont PD Altrichter. Weiter wird aktuell in einer Phase-3-Studie untersucht, ob Dupilumab, eine Substanz, die für die Behandlung von Neurodermitis zugelassen ist, auch für die Behandlung der chronisch spontanen Urtikaria und Angioödemen wirksam sein könnte. Erste, erfolgversprechende Daten liegen auch für ein Molekül mit der Bezeichnung Fenebrutinib vor, ein Bruton-Tyrosinkinase Inhibitor (BTKi), der ebenfalls oral verabreicht wird. Auch zu Remibrutinib, einem experimentellen Arzneistoff aus der Gruppe der Tyrosinkinasehemmer, der zur Subgruppe der BTK-Inhibitoren gehört, läuft eine Phase III Studie, wie PD Altrichter berichtet.
***PD Dr. med. Sabine Altrichter, „Biologika, Angioödeme und chronische Urtikaria“, Allergieakademie der DGAKI, Allergie im Fokus „Biologika“ 13. und 14. Januar 2023
Biologika zur Therapie von Nasenpolypen
Bei chronischer Rhinosinusitis mit Polyposis nasi (Nasenpolypen) können bereits mehrere Biologika zum Einsatz kommen. Weitere Therapieansätze sind Gegenstand von Forschungsuntersuchungen.
Biologika als „Game Changer“ für die Behandlung von Nasenpolypen
„Biologika haben bei der Behandlung einer Chronischen Rhinosinusitis mit Nasenpolypen (CRSwNP) zu einem Paradigmenwechsel geführt“, das stellte Prof. Dr. med. Martin Wagenmann, geschäftsführender Oberarzt und Leiter des Schwerpunkts Rhinologie, Allergologie und Endoskopische Schädelbasischirurgie am Universitätsklinikum Düsseldorf (UKD), bei der DGAKI-Fachkonferenz zu Biologika**** fest. Für die Patienten bedeutet dies „Licht am Ende des Tunnels“, denn die Lebensqualität wird durch Nasenpolypen stark eingeschränkt. Hinzu kommt: Häufig gehen Nasenpolypen auch mit anderen Erkrankungen einher. So leiden Patienten mit Nasenpolypen oft auch unter Asthma bronchiale oder allergischer Rhinitis. Auch eine Aspirin-Sensitivität, die auch als Analgetika-Intoleranz oder NERD (NSAID-ERD: nonsteroidal antiinflammatory drug exacerbated respiratory disease) bezeichnet wird, findet man häufig bei Nasenpolypen-Patienten.
Nasenpolypen: Kortison und Operationen helfen oft nicht
Oft hilft die Behandlung mit intranasalen oder gar systemischen Steroiden den Patienten mit Nasenpolypen nicht. Dann sind operative Eingriffe der nächste Schritt. „Allerdings kann es bei diesen Operationen zu Komplikationen kommen und oft kommen die Nasenpolypen auch wieder, deswegen ist es erfreulich, dass uns mittlerweile zur Begleittherapie der Polyposis nasi sogar mehrere Biologika zur Verfügung stehen“, stellt Prof. Wagenmann fest.
| Biologika bei Nasenpolypen als Zusatztherapie zu intranasalen Steroiden | |
| Substanz | Status |
| Dupilumab | zugelassen |
| Omalizumab | zugelassen |
| Mepolizumab | zugelassen |
| Benralizumab | Studienphase |
| Tezepelumab | Studienphase |
| Quelle: Prof. Dr. med. Martin Wagenmann, www.mein-allergie-portal.com | |
****Prof. Dr. med. Martin Wagenmann, “Rhinitis und Polyposis nasi“, Allergieakademie der DGAKI, Allergie im Fokus „Biologika“ 13. und 14. Januar 2023
Wie werden Biologika eingenommen, wie oft und wie lange?
Damit Biologika überhaupt als wirksames Arzneimittel am „Ort des Geschehens“ ankommen, können sie nicht als Tablette verabreicht, sondern müssen parenteral appliziert werden. Das bedeutet, dass der Patient entweder eine Spritze subkutan, das heißt unter die Haut, in den Oberschenkel oder die Bauchdecke injiziert oder das Medikament als Infusion intravenös, also in die Vene, erhält. Die Injektion unter die Haut können die Patienten selbst erlernen und durchführen, für eine intravenöse Anwendung muss er eine Arztpraxis aufsuchen. Der Abstand der Applikationen bzw. Injektionen beträgt in der Regel eine bis mehrere Wochen. Die Behandlungsdauer ist längerfristig bis lebenslang, mindestens jedoch drei Monate, um festzustellen, ob ein positiver Wirkeffekt beim Patienten zu beobachten ist.
Welchen Patienten helfen Biologika und welchen nicht?
Patienten sprechen unterschiedlich gut auf die Wirkung von Medikamenten an, das ist auch bei den Biologika so. Wenn ein Patient nicht auf eine bestimmte Therapie anspricht, so nennt man ihn einen Non-Responder. Es gibt verschiedene Studien, die versuchen geeignete Prädiktoren, also Vorhersagemarker, zu finden um das Ansprechen auf Biologika vorherzusagen. Beispielsweise spielt es bei der Behandlung mit TNF-alpha-Blockern eine Rolle, wie hoch die Expression von TNF-alpha oder die Anzahl von Makrophagen, das sind sogenannte Fresszellen, beim Patienten vor Beginn der Behandlung ist. Je besser das Verständnis über die pathophysiologischen Grundlagen einer Erkrankung ist, desto gezielter können bestimmte Biomarker gefunden werden, die es erlauben, das Ansprechen auf bestimmte Medikamente vorherzusagen.
Es gibt primäre Non-Responder, das sind Patienten, die von Anfang an nicht auf die Behandlung ansprechen, und sekundäre Non-Responder. Diese Patienten entwickeln erst im Laufe der Behandlung eine Resistenz gegen den Wirkstoff, indem sie beispielsweise neutralisierende Antikörper gegen den Wirkstoff entwickeln.
Können auch Kinder mit Biologika behandelt werden?
Biologika werden zunehmend auch bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt. Es gibt jedoch nur wenige hochwertige Studien zur Beurteilung von Wirksamkeit, Sicherheit und Stellenwert von Biologika-Einsatz bei Kindern und Jugendlichen. Sie sind jedoch weder bei Asthma bronchiale, Psoriasis, juveniler idiopathischer Arthritis, noch bei chronisch-entzündlichen Darmerkrankungen Mittel der ersten Wahl. Sie stellen aber eine Erweiterung der Therapiemöglichkeit dar, wenn andere herkömmliche immunmodulatorische Medikamente nicht wirken. Hier besteht noch großer Forschungsbedarf auch mit systematischer Langzeiterfassung von unerwünschten Wirkungen.
Gibt es bei Biologika Nebenwirkungen? Welche?
Biologika sind im Allgemeinen recht gut verträglich, weil sie aus körpereigenen bzw. sehr ähnlichen Substanzen entstehen. Daher sind Allergien oder Unverträglichkeiten eher selten.
Es können jedoch grippeähnliche Beschwerden wie Kopfschmerzen, Gliederschmerzen oder Fieber auftreten. Des Weiteren kann es zu Blutbildveränderungen kommen in Form von Leukozytose oder Leukopenie, Thrombozytopenie oder Anämie (das sind zu viele oder zu wenige weiße Blutzellen, zu wenig Blutplättchen oder eine Blutarmut). Auch die Leberenzymwerte können bei einer Biologika-Therapie ansteigen. Zu erwähnen sind weiterhin lokale Reaktionen an der Einstichstelle. Möglicherweise gibt es auch kardiovaskuläre Nebenwirkungen. Unter Dupilumab-Therapie kann es zu Lid- und Bindehautentzündungen sowie Augenjucken kommen, was aber gut behandelbar ist.
Generell gilt, dass unter einer immunsuppressiven Therapie regelmäßig der Impfstatus überprüft und entsprechend aufgefrischt werden muss, da generell eine höhere Infektanfälligkeit besteht.
Für eine Gruppe der Biologika, die TNF-alpha-Blocker, gelten besondere Kontraindikationen bzw. Vorsichtsmaßnahmen. Bereits immunsupprimierte Personen dürfen diese zum Beispiel nicht erhalten, da das Risiko für opportunistische Infektionen, deutlich ansteigt. Bei Multipler Sklerose dürfen TNF-alpha-Blocker ebenfalls nicht eingesetzt werden, da Studien eine Verschlechterung der Erkrankung nachgewiesen haben. Eine TNF-alpha-Blocker-Therapie steigert zudem das Auftreten von Krebserkrankungen, insbesondere Lymphomen. Außerdem sollte vor jedem Einsatz eines dieser Medikamente ein sogenannter Quantiferon-Test durchgeführt werden, um eine nicht-aktive Tuberkulose auszuschließen. Diese würde sonst unter der Therapie sehr wahrscheinlich reaktiviert werden.
Welche Ärzte verschreiben Biologika?
In erster Linie werden Biologika entsprechend ihrer Indikation von Ärzten verschrieben bzw. eingesetzt, die an der Behandlung von Erkrankungen mit autoimmuner Komponente beteiligt sind. Das sind also Rheumatologen, Dermatologen, Gastroenterologen und Neurologen. Für den Einsatz von Biologika in der Krebstherapie sind die Onkologen zuständig. Pulmologen werden sich um die Rezeptierung geeigneter Präparate bei der Asthma-Therapie kümmern, HNO-Ärzte bei Nasenpolypen. Nach einer Organtransplantation verschreibt der Transplantationsmediziner die entsprechenden Medikamente.
Werden Biologika auch von der Krankenkasse bezahlt? Wie hoch sind die Kosten?
Biologika sind sehr kostenintensive Medikamente. Sie gehören sogar zu den umsatzstärksten Medikamenten in Deutschland. Eine einjährige Biologika-Therapie eines Patienten verursacht Kosten von 50.000 bis 100.000 Euro, das ist ca. 10 bis 100fach teurer als die Basismedikation der entsprechenden Erkrankung.
Prinzipiell ist es so, dass ein Facharzt entscheiden muss, ob eine Biologika-Therapie für die entsprechende Erkrankung indiziert ist, weil andere Therapiemaßnahmen vielleicht nicht mehr ausreichend sind. Er kann dann bei der Krankenkasse die Übernahme der Kosten beantragen. Die Krankenkasse überprüft den Antrag und entscheidet über die Kostenübernahme.
Biologika in der Forschung
Es gibt zahlreiche Forschungsgebiete in Bezug auf die Einsatzgebiete, Therapieoptimierung und Sicherheit von Biologika bei Erkrankungen mit allergischer Komponente. Dabei ist es wichtig, die Erforschung der Pathomechanismen der Erkrankung voranzutreiben, um zukünftig die molekularen Therapien immer zielgerichteter einsetzen zu können. Sowohl bei Asthma, als auch bei Hautallergien konnten dafür in letzter Zeit bestimmte Endotypen differenziert werden. Beim Asthma beispielsweise liegt der Fokus aktueller Forschungen auf von Epithelzellen gebildeten Zytokinen, die am Entzündungsgeschehen beteiligt sind, so dass zielgerichtetere Wirkstoffe entwickelt werden können. Für die chronisch-spontane Urtikaria laufen umfangreiche Studien zur Wirksamkeit anderer als bisher zugelassener Biologika. Auch im Bereich der Therapie des Atopischen Ekzems sind Forschungen sehr bemüht, geeignete Biologika mit guter Wirksamkeit und günstigem Nebenwirkungsprofil zu identifizieren. Von der Polyposis nasi, den Nasenpolypen, weiß man dank verschiedener Forschungen inzwischen, dass es sich um eine heterogene Gruppe von Mukosa-Erkrankungen mit unterschiedlicher Pathophysiologie handelt. Die unterschiedlichen Signalwege, die den Entzündungsprozess auslösen, aufrechterhalten und chronifizieren, sind auch hier Gegenstand aktueller Forschungen, um genaue Indikationen für den Einsatz von Biologika bei Patienten mit Nasenpolypen stellen zu können.
Neue Therapieformen in der Allergologie – woran wird geforscht?
Wie Prof. Worm, Leiterin der Hochschulambulanz und Lehrkoordinatorin der Klinik für Dermatologie, Venerologie und Allergologie an der Charité Berlin, im Rahmen der DGAKI-Fachkonferenz zu Biologika***** berichtet, werden aktuell zahlreiche Untersuchungen zur Wirksamkeit von Biologika durchgeführt. Vor allem im Bereich der Nahrungsmittelallergien, Asthma bronchiale und chronischer Urtikaria werden derzeit klinische Studien, in reduziertem Maße auch zu Neurodermitis und den Pollenallergien durchgeführt. „Im Zentrum der Studien stehen dabei monoklonale Antikörper sowie kleine Moleküle wie JAK-Inhibitoren (JAKi) und Bruton-Tyrosinkinase Inhibitoren (BTKi), so Prof. Worm. Dabei werden häufig auch Substanzen, für die bereits eine Zulassung für eine atopische Erkrankung vorliegt, auf ihr Therapiepotenzial für andere allergisch bedingte Erkrankungen untersucht. Das liegt daran, dass diese Erkrankungen eine Gemeinsamkeit haben, die Typ-2-Entzündung oder Typ-2-Inflammation. Man geht deshalb davon aus, dass Therapien, die bei einer allergischen Erkrankung bereits gut funktionieren, auch auf andere allergische Erkrankungen übertragbar sein könnten.
| Beispiele für aktuelle klinische Studien zur Behandlung allergischer Erkrankungen | |
| Substanz | Erkrankung |
| CNP-201 (verkapseltes Erdnussprotein) | Allergie auf Erdnuss |
| Abrocitinib (JAK-Inhibitor) | Allergie auf Erdnuss |
| Ligelizumab (Anti-IgE) | Allergie auf Erdnuss |
| Remibrutinib (Bruton-Tyrosinkinase Inhibitor) | Nahrungsmittelallergie |
| Barzolvolimab (CDX-0159) (monoklonaler Antikörper) | Chronisch spontane Urtikaria |
| Remibrutinib (Bruton-Tyrosinkinase Inhibitor) | Chronisch spontane Urtikaria |
| Quelle: Prof. Dr. med. Margitta Worm, www.mein-allergie-portal.com |
|
*****Blick auf Phase 3 Studien mit neuen Molekülen in der Allergologie", Prof. Dr. med. Margitta Worm, Allergieakademie der DGAKI, Allergie im Fokus „Biologika“ 13. und 14. Januar 2023
Quellen:
Wirksamkeit und evidenzbasierter Einsatz von Biologika bei Kindern und Jugendlichen
Biologika: Starke Waffen mit Nebenwirkungen - IGPmagazin Ihre Gesundheitsprofis
Biologika: Schwache Abwehr - teuer bezahlt
Dermatologen aktualisieren Leitlinie zu Neurodermitis
Einsatz von Biologika bei chronischer spontaner Urtikaria – auch jenseits einer Omalizumab-Therapie?
Praktischer Umgang mit allergischen Reaktionen auf COVID-19-Impfstoffe. DOI: 10.1007/s15007-021-4773-1.
Monoklonale Antikörper zur Behandlung von Asthma und Hautallergien
Chronische Rhinosinusitis mit Nasenpolypen: Biologika auf dem Prüfstand
Wichtiger Hinweis
Unsere Beiträge beinhalten lediglich allgemeine Informationen und Hinweise. Sie dienen nicht der Selbstdiagnose, Selbstbehandlung oder Selbstmedikation und ersetzen nicht den Arztbesuch. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.
Autor: Dr. med. Anna Eger, Prof. Dr. med. Margitta Worm, PD Dr. med. Sabine Altrichter, Prof. Dr. med. Martin Wagenmann, Prof. Dr. med. Christian Taube, Prof. Dr. med. Thomas Werfel, www.mein-allergie-portal.com
Lesen Sie auch
-
Allergie-Sprechstunde online: Schnelle Hilfe ohne Wartezeit
-
Alternative Behandlung bei Allergien
-
Wie erkennt man eine allergische Reaktion?
Weitere Beiträge
News - Allergie Allgemein
- Update Allergologie - Immunologie: Was ist neu?
- 20 Jahre Allergologie im Kloster: Neues zu Diagnostik & Therapie
- Deutscher Allergiekongress 2023: Ein Blick in die Zukunft
- CFS: Wie kommt es zum chronischen Fatigue-Syndrom?
- Alternative Heilmethoden bei Allergien, geht das?
- Allergie – was ist das?
- Allergien dank molekularer Allergologie verhindern?
- Biologika bei Asthma, Neurodermitis, Urtikaria, Nasenpolypen
MeinAllergiePortal wird unterstützt von