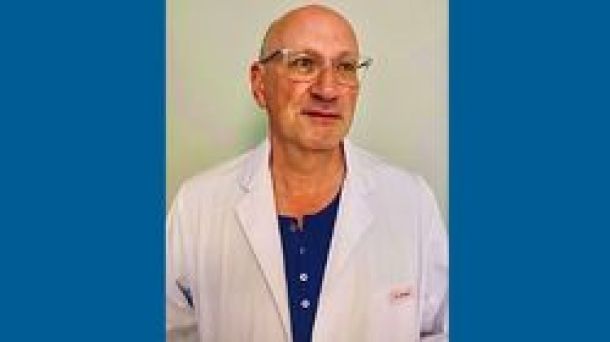Histaminintoleranz (HIT) – was kann man noch essen?

Die Histaminintoleranz (HIT) gehört zu den Nahrungsmittelunverträglichkeiten und die Zahl der Menschen, die den Eindruck haben, auf Histamin „unverträglich“ reagieren, steigt stetig an. Oft lautet der erste Ratschlag, histaminreiche Lebensmittel zu meiden. Das ist jedoch leichter gesagt als getan, denn Histamin ist nicht so leicht "zu fassen". Dass Histamin in gereiften Lebensmitteln wie Salami, Käse, Essig und Konserven reichlich vorhanden ist, leuchtet ein, aber was ist mit natürlichen Nahrungsmitteln - was kann man noch essen? MeinAllergiePortal sprach mit Dipl. oec. troph. Ulrike Breunig, Ernährungsberatung und –therapie in München, über "Histamin-Verstecke", histaminarme und histaminreiche Nahrungsmittel und was bei Histaminintoleranz verträglich ist.
Autor: Sabine Jossé M. A.
Interviewpartner: Dipl. oec. troph. Ulrike Breunig
Frau Breunig, was darf man bei Histaminintoleranz essen, was lieber nicht?
Bei einer Histaminintoleranz muss der Ernährungsplan sehr individuell erstellt werden. Auch muss bei einer histaminarmen Ernährung berücksichtigt werden, dass, neben Histamin auch andere biogene Amine die Beschwerden hervorrufen können. Die folgenden Empfehlungen gelten deshalb auch nicht generell, sondern sollten ausschließlich im Rahmen einer individuellen und fachkompetenten Ernährungsberatung zur Anwendung kommen.
Ist Gemüse verträglich bei Histaminintoleranz?
Gemüse in seiner natürlichen Form ist überwiegend histaminarm, dazu gehören unter anderem:
- Gurken
- Karotten
- Lauch- und Zwiebelgewächse (sofern Blähungen nicht zu den Symptomen gehören)
- Salat
- Pastinaken
- Rote Bete frisch oder in der Folie
- Schwarzwurzel
- Alle Kohlsorten wie Blumenkohl, Rotkohl, Brokkoli, Rosenkohl (sofern Blähungen nicht zu den Symptomen gehören)
- Sellerie
- Kürbis
- Mais
- Paprika
- Fenchel
Ausnahmen bilden:
- Spinat
- Frische Tomaten oder Tomatensoße aus frischen Tomaten
- Dosentomaten
- Auberginen
- Avocado
- Oliven
- Pilze
- Milchsauer eingelegtes Gemüse wie zum Beispiel Essiggurken, rote Bete oder Sauerkraut
Ist bei Histaminintoleranz Obst verträglich?
Frisches Obst stellt kein Problem dar, sofern folgende Obstsorten gemieden werden:
- Bananen
- Sämtliche Zitrusfrüchte wie beispielsweise Orangen, Grapefruit, Mandarinen etc
- Ananas
- Kiwi
- Himbeeren
- Erdbeeren
Kann man bei Histaminintoleranz Fleisch essen?
Muskelfleisch ist von Natur aus arm an biogenen Aminen, enthält jedoch einen hohen Anteil an Histidin. Histidin baut sich mit zunehmender Lagerung und Konservierung zu Histamin um. Dadurch ist gelagertes, konserviertes Fleisch sehr histaminreich und schlecht verträglich, wenn man eine Histaminintoleranz hat.
Nicht verzehrt werden sollten rohe, gepökelte und geräucherte Fleischwaren wie beispielsweise:
- Salami
- Parmaschinken
- Serranoschinken
- Landjäger
- Leberwurst
- Cervelatwurst
- Bündner Fleisch
Problemlos verträglich bei Histaminintoleranz ist dieses Fleisch:
- Frisches, nicht abgepacktes Fleisch
- Tiefgekühltes Fleisch
- Frisch hergestelltes Hackfleisch
- Frisches oder tiefgekühltes Geflügel
Am besten man lässt Hackfleisch frisch vom Metzger herstellen und verbraucht es sofort. Eine unter Schutzatmosphäre verpackte, frisch im Laden eingetroffene Lieferung kann unter Umständen schon zu viel Histamin enthalten. Vorsicht ist auch bei aufgewärmten oder lang gegarten Fleischgerichten wie Gulasch oder Rouladen geboten
Auch frische Eier können bei einer Histaminunverträglichkeit ohne Probleme gegessen werden.
Welche Wurst ist verträglich bei Histaminintoleranz?
Bei Histaminintoleranz verträgliche, histaminarme Wurstsorten sind:
- Frischwurstaufschnitt wie Schinkenwurst oder Bierschinken
- Gekochter Schinken
- Fleisch in Aspik
Wie sieht es bei Fisch aus, ist kann man Fisch essen, wenn man eine Histaminunverträglichkeit hat?
Fisch ist nicht - wie oft vermutet - pauschal histaminreich. Bei fangfrischem oder tiefgekühltem "weißen" Fisch muss man sich keine Gedanken machen.
Reich an Histidin sind allerdings die folgenden Fische:
- Thunfisch
- Makrele
- Sardinen
Man sollte sie deshalb unbedingt meiden, wenn man an einer Histaminintoleranz leidet.
Histaminreich und nicht gut verträglich sind auch haltbar gemachte Fische wie:
- Räucherfisch
- Fischkonserven wie Matjes, Rollmops, Hering
- Fermentierte Fischsaucen
- Anchovis
Und: Meeresfrüchte und Schalentiere gehören zu den Histaminliberatoren, weshalb sie selbst in frischem Zustand unverträglich sein können, wenn man ein Problem mit Histamin hat.
Bei Restaurantbesuchen ist Vorsicht geboten, da man nie genau weiß, ob und wie lange die Tiefkühlkette von frischem Fisch unterbrochen wurde.
Wie sieht es aus mit den Beilagen, was ist möglich bei Histaminunverträglichkeit?
Kartoffeln, Reis und Nudeln können bei Histaminintoleranz problemlos verzehrt werden. Aufpassen muss man bei Fertigprodukten und Halbfertigprodukten. Kartoffelgerichte enthalten häufig Geschmacksverstärker, die bei Histaminintoleranten fast immer Beschwerden hervorrufen.
Speisefette und Öle stellen in der histaminarmen Ernährung kein Problem dar.
Ist es möglich in einem Restaurant histaminfreies Essen zu bekommen? Oder raten sie histaminintoleranten Personen eher davon ab, Essen zu gehen bzw. Essen zu bestellen?
Restaurantbesuche oder Essen bei Einladungen gehören zu unserem Leben dazu. Erfahrungsgemäß ist das ständige Meiden von solchen Anlässen nicht erforderlich. Wie häufig außer Haus Essen nei Histaminunverträglichkeit möglich ist, hängt auch davon ab, wie stark die Symptome danach sind und wie lange die Beschwerden persistieren.
Folgende Tipps können die Situation beim Essen außer Haus bei Histaminintoleranz entschärfen:
- Alkohol auf eine kleine Menge beschränken und nur zum Essen konsumieren. Ungünstig ist ein Aperitif oder Alkohol zwischen den Hauptmahlzeiten, zum Beispiel Sekt als Stehempfang
- Komplexe Mahlzeiten mit vielen Zutaten meiden, zum Beispiel:
- Aufläufe
- Gerichte mit viel Soße
- Dressings
- Dips
Stattdessen einfache Gerichte bevorzugen, deren Bestandteile erkennbar sind, zum Beispile eine Kombination aus Beilagen wie:
- Reis
- Kartoffeln
- Nudeln mit Gemüse und Fleisch, Fisch oder Tofu. Falls es Soßen gibt, diese separat in einem Schälchen bringen lassen, sodass nicht das gesamte Essen in der Soße verschwindet. Salate am besten selbst anmachen.
Probleme gibt es erfahrungsgemäß häufiger bei asiatischem Essen in Deutschland, während asiatisches Essen in Asien oft sehr gut vertragen wird. Die Originalküche unterscheidet sich doch immer wieder von der Art, wie asiatische Küche hierzulande zubereitet wird.
Es hat sich auch bewährt, mit der Bedienung zu sprechen und auf die Besonderheiten hinzuweisen. Das sensibilisiert die Küche für den Bedarf der Kunden. Gute Restaurants gehen nach Möglichkeit gern auf die Wünsche der Kunden ein.
Als Fazit kann man sagen, dass es nicht um schwarz-weiß-Denken geht, sondern darum, Spielräume zu finden, die funktionieren und damit wieder ein Gefühl der Normalität beim Essen zu ermöglichen.
Kommen wir zu den Milchprodukten, sind sie verträglich bei Histaminintoleranz?
Ob Milchprodukte bei einer Histaminintoleranz verträglich sind, kommt auf deren Reifegrad an.
Zu den histaminarmen Milchprodukten gehören:
- Frischkäse
- Mozzarella
- Ricotta
- Junge Schnittkäsesorten, wie junger Gouda oder Butterkäse
- Quark
- Schichtkäse
- Hüttenkäse
- Joghurt
- Milch
- Buttermilch
- Sahne
Zu meiden sind histaminreiche Hartkäsesorten wie:
- Parmesan
- Alter Gouda
- Emmentaler
- Harzer
- Tilsiter
- Reifer Camembert
- Roquefort bzw. Schimmelkäse
Sind Milchersatzprodukte histaminarm und empfehlenswert bei Histaminunverträglichkeit?
Bei Milchersatzprodukten ist daran zu denken, dass dies durch ein Fermentationsverfahren leicht süsslich gemacht werden. Das ist bei Reisdrinks der Fall und dementsprechend sind diese auch nicht ganz histaminfrei. Ähnlich verhält es sich vermutlich bei Hirse- und Haferdrinks. Kokosmilch ist verträglich. Sojamilch ist ungeeignet.
Welches Brot eignet sich bei Histaminintoleranz?
Brot und Getreideprodukte verursachen bei einer Histaminunverträglichkeit in der Regel keine Beschwerden. Allerdings muss man wissen, dass es bei sehr frischen Backwaren immer zu einem unruhigen Bauch kommen kann. Brot vom Vortag, getoastetes Brot, sowie Zwieback, Toastbrot und Knäckebrot sind am besten verträglich. Grobe Brote wie Schrotbrote oder Pumpernickel sind grundsätzlich schwerer verdaulich und können auch bei Gesunden zu Bauchbeschwerden führen. Roggensauerteigbrote führen hin und wieder zu Beschwerden. Bei vorliegendem Durchfall empfiehlt es sich, den Ballaststoffgehalt durch den Einsatz von Auszugsmehlen zu senken. Man kann ein histaminarmes, bekömmliches Brot natürlich auch selbst backen.
Was darf aufs Frühstücksbrot bei Histaminintoleranz?
Marmelade aus geeigneten Früchten kann man bei Histaminunverträglichkeit ohne Probleme essen. Zu meiden sind Nusscremes, Erdbeermarmelade sowie Marmelade aus unverträglichen Obstsorten. Auch die erwähnten verträglichen Wurst- und Käsesorten kann man sich ohne Probleme schmecken lassen.
Und für die Naschkatzen: Welche Süßigkeiten haben Histamin und welche nicht?
Von den Süßwaren sind unverträglich dunkle Schokolade und andere mit Kakao hergestellte Produkte, sowie Carobpulver. Weiße Schokolade geht deutlich besser. Was man trotz Histaminintoleranz durchaus essen kann, sind Lakritze, Reiswaffeln, Pudding außer Schoko und Nuss und Eis außer Walnusseis.
Und welche Knabbereien oder Snacks kann man bei Histaminintoleranz essen?
Knabberartikel mit Glutamat sollte man meiden. Generell sollten Knabberartikel in geringen Mengen gegessen werden.
Verträgliche Knabberartikel bei Histaminintoleranz sind:
- Chips mit den Zutaten: Kartoffeln, Salz, Sonnenblumen- oder Rapsöl
- Kräcker
- Popcorn
- Reisgebäck
- weiße Schokolade
Kommen wir zu den Getränken, was darf man bei Histaminintoleranz trinken?
Zu den unbedenklichen Getränken gehören:
- Mineralwasser
- Kräutertee
- Früchtetee
- Apfelsaft
- Johannisbeersaft
- Traubensaft
- Kirschsaft
- Kaffee und schwarzer Tee sollten generell nur in Maßen getrunken werden.
In der histaminarmen Kost sollte man meiden:
- Kakao
- Fruchtsäfte aus Zitrusfrüchten und unverträglichen Obstsorten
- Ananassaft
- Multivitaminsaft
Darf man bei Histaminintoleranz Alkohol trinken?
Alkoholische Getränke, vor allem Rotwein und Sekt, bereiten Histaminintoleranten nahezu immer Beschwerden. Auch Bier und Weißwein sind oft nur in geringen Mengen symptomfrei verträglich.
Am besten tolerieren Betroffene, in geringen Mengen, Spirituosen wie:
- Kräuterliköre
- Korn
- Grappa
- Wodka
- Whisky
Wichtig zu wissen ist: Alkohol wirkt auch als Histaminliberator und erhöht zudem die Durchlässigkeit der Darmwand. Außerdem ist bei flüssigen Substanzen die Darmpassage erhöht. Das alles führt dazu, dass Histamin durch Alkohol schneller im Körper aufgenommen wird. Die unerwünschte Wirkung von Alkohol wird verstärkt, wenn er warm getrunken wird, zum Beispiel als Glühwein. Auch wenn das alkoholische Getränk kohlensäurehaltig oder gezuckert ist, kann man bei Histaminintoleranz Probleme bekommen, ebenso bei Konsum von Alkohol auf leeren Magen.
Wenn Alkohol ein Histaminliberator ist, warum ist histaminarmer Wein dann für viele Menschen mit HIT gut verträglich?
Die Verträglichkeit von histaminarmen Weinen lässt die Vermutung zu, dass die Wirkung von Alkohol als Histaminliberator nur eine untergeordnete Rolle spielt. Andernfalls würden manche Betroffene Grappa oder Whiskey nicht vertragen. Trotz teilweise guter Verträglichkeit von histaminarmem Wein ist zu empfehlen, diesen nur in kleinen Mengen zu trinken und immer gemeinsam mit histaminarmer und fester - nicht scharf gewürzter - Kost, um die Darmpassage insgesamt zu verlangsamen. Darüber hinaus wäre zu klären, inwieweit Schwefel bzw. Sulfit im Wein zu Beschwerden führt. Denn nicht jede histaminempfindliche Person bleibt beim Genuss von histaminarmen Wein beschwerdefrei.
Ist alkoholfreies Bier bei HIT ebenfalls verträglich?
Bei den Bieren unterscheidet man zwischen ober- und untergärigen Biersorten, wobei die obergärigen wie Kölsch oder Weißbier einen höheren Histamingehalt aufweisen als untergärige wie Pils oder Export. Auch alkoholfreie Biere enthalten Histamin, daher ist alkoholfreies Bier bei Histaminintoleranz nicht zwingend verträglich.
Wie sieht es bei einer Histaminintoleranz mit der Verträglichkeit von Kräutern und Gewürzen aus, was ist erlaubt, was ist verboten?
Erlaubte Kräuter, Gewürze und Würzmittel bei HIT sind:
- Salz
- Pfeffer
- Frische oder tiefgefrorene Kräuter
- Apfelessig
- Essigessenz
- Gewürzmischungen bzw. Gemüse- oder Fleischbrühe frei von Glutamat, frei von Hefe und Zusatzstoffen
- Vanillemark
- Backpulver
- Senf
- Mayonnaise
Zu meiden sind bei HIT:
- Balsamicoessig rot und weiß
- Rotweinessig
- Tafelessig
- Tomatenmark
- Ketchup
- Würzsoßen
- Fermentierte Sojaprodukte wie beispielsweise Sojasauce, Miso, Natto, Tempeh, Sufu sowie Austernsauce
- Glutamat
- Hefeextrakte
- Hefepasten
Beim Würzen muss bedacht werden, dass scharfe Gewürze die Histaminaufnahme im Magen-, Darmsystem begünstigen. Daher sollte bei einer histaminarmen Ernährung auf scharfe Gewürze verzichtet werden.
Sie erwähnten, dass man Histaminliberatoren meiden sollt – was ist das und welche Nahrungsmittel gelten als solche?
Histaminliberatoren sind Substanzen, welche die Freisetzung von körpereigenem Histamin fördern.
Zu den Histaminliberatoren gehören:
- Alkohol
- Zitrusfrüchte wie Orangen, Grapefruit, Zitrone
- Papaya
- Erdbeeren
- Ananas
- Kiwi
- Nüsse
- Tomaten
- Kakao
- Schokolade
- Schalentiere
- Hülsenfrüchte
Bei der Frage ob Backhilfen wie Hefe und Backpulver für Menschen mit Histaminintoleranz verträglich sind, scheint es unterschiedliche Einschätzungen zu geben, wie lautet Ihre Empfehlung?
Der Einsatz von Hefe als Backtriebmittel ist für Histaminintoleranz, anders als häufig aufgeführt, in der Regel unproblematisch. Dennoch klagen Menschen mit einer Histaminintoleranz hin und wieder über Symptome nach dem Verzehr von Brot- und Backwaren, die mit Hefe hergestellt worden sind. Untersuchungen haben aber gezeigt, dass Frischhefe oder Trockenhefe keine nennenswerten Histaminmengen enthalten und daher bei Histaminintoleranz verträglich sind. Wohl aber können hefehaltige Produkte histaminhaltig sein. Das liegt vermutlich am Herstellungsprozess. Auch wenn die verwendete Hefe selbst nicht histaminhaltig ist, kann sie Histamin produzieren, während sie aktiv ist und einen Teig aufgehen lässt. Dadurch enthalten Brot- und Backwaren, bei denen der Teig sehr luftig ist, häufig sehr viel mehr Histamin als festere Brotsorten.
Die Verwendung von Backpulver stellt in der histaminarmen Ernährung kein Problem dar.
Warum sollte man dann bei Histaminintoleranz Hefeextrakt meiden?
Hefeextrakt entsteht aus enzymatisch behandelter Hefe und enthält Glutamat. Es wird häufig verwendet in Bouillons, Saucen, Fertigmahlzeiten und Würzmischungen, um den Speisen ein kräftigeres Aroma zu verleihen. Glutamat als Zusatzstoff ist inzwischen verpönt, daher wird mittlerweile eher Hefeextrakt eingesetzt.
Auch in Bezug auf bei Nüssen, Samen und Hülsenfrüchte liest man widersprüchliche Angaben. Was empfehlen Sie Ihren Histamin-Patienten?
Eine histaminarme Ernährung sollte frei sein von Hülsenfrüchten, Nüssen und Samen. Hülsenfrüchte werden wegen ihrer Blähwirkung von den meisten Patienten sowieso gemieden. Das Ziel ist zunächst, über eine strenge Karenz eine deutlich Symptombesserung zu erzielen. Wenn das erreicht ist, können in der Testphase andere Lebensmittel mit etwas höherem Gehalt an Histamin, biogenen Aminen oder Histaminliberatoren - unter Anleitung in geringer Menge - eingeführt werden, um so sukzessiv den Speiseplan langsam zu erweitern. Ziel der Ernährungstherapie ist, die Einschränkung so gering wie möglich zu halten, damit Lebensqualität und Nährstoffsicherheit erhalten bleiben.
Welche Rolle spielen Zusatzstoffe bei der Histaminintoleranz?
Zusatzstoffe können eine erhöhte Histaminfreisetzung im Körper bewirken.
Zu den Zusatzstoffen gehören zum Beispiel:
- Farbstoffe wie Tartrazin in Gummibärchen, Chinolingelb, Gelborange
- Geschmacksverstärker wie Glutamat
- Konservierungsmittel wie Benzoate und PHB (Para-Hydroxy-Benzoesäure), Ester, Sulfite
- Säureregulatoren
- Antioxidantien
- Nitrite
Wie kann man wissen, wie viel Histamin ein bestimmtes Nahrungsmittel enthält?
Histaminwerte in Lebensmitteln hängen jeweils von der Frische und den Lagerbedingungen ab. Feuchtigkeit, Wärme, Luft sind ideale Wachstumsbedingungen für Mikroorganismen. Generell gilt: Je länger das Nahrungsmittel gelagert und je höher die Temperatur ist, desto höher ist der Histamingehalt. In verderblichen Lebensmitteln kann sich enorm viel Histamin entwickeln. Vor allem Fisch, Meeresfrüchte und Fleisch sind hoch verderblich. Schon nach wenigen Minuten ohne Kühlung kann der Histaminwert weit angestiegen sein. Außerdem steigt der Histamingehalt tendenziell mit dem Zerkleinerungsgrad von Fleisch. Zum Beispiel wird Hackfleisch rasch unverträglich. Einmal entstandenes Histamin kann weder durch Erhitzen noch durch andere Methoden wieder entfernt werden. Ununterbrochene gute Kühlung und gute Hygiene sind deshalb wichtig. Tiefkühlen, verlangsamt die Entstehung von Histamin noch stärker, kann sie aber nicht ganz stoppen.
Wie kann man wissen, wie viel Histamin man am Tag schon zu sich genommen hat?
Es gibt keine Möglichkeit, die zugeführte Menge an Histamin korrekt nachzuvollziehen. Wenn man jedoch die Grundregeln für eine histaminarme Ernährung inklusive richtiger Lagerbedingungen beachtet, ist man auf der sicheren Seite.
Was kann passieren, wenn man trotz Histaminintoleranz weiter histaminhaltig isst, gibt es Langzeitfolgen?
Eine histaminarme Ernährung ist auf Dauer selten erforderlich. Wenn Histamin der Auslöser für ein bestehendes Symptombild ist, werden sich die Beschwerden nach der Eliminationsphase, das heißt durch eine histaminarme Ernährung, reduzieren bzw. verschwinden. Im nächsten Schritt, im Kostaufbau, wird die individuelle Toleranzgrenze für histaminhaltige Lebensmittel ermittelt. Nicht jeder Betroffene reagiert in derselben Intensität auf Histamin. Darüber hinaus spielen nicht nur Lebensmittel im Einzelnen eine Rolle. Ebenso entscheidend für die Verträglichkeit von histaminreicheren Lebensmitteln ist die Gesamternährung, zum Beispiel die Ausgewogenheit von Kohlenhydraten, Fetten und Eiweiß, die Zubereitungsart sowie das Essverhalten an sich. Unregelmäßige Mahlzeiten, hastiges Essen oder Spätmahlzeiten können das Symptombild begünstigen bzw. verstärken. Andersherum ermöglichen bessere Rahmenbedingungen mehr Spielraum in der Auswahl von Lebensmitteln. Je mehr Stellschrauben in der gesamten Ernährung optimiert werden, umso mehr Spielraum besteht in der Möglichkeit für eine großzügigere Lebensmittelauswahl und damit eine Verbesserung der Lebensqualität.
Bisher konnte nicht nachgewiesen werden, dass aufgrund einer unbehandelten Histaminintoleranz Langzeitfolgen zu erwarten sind, wie zum Beispiel die Entwicklung von chronischen Erkrankungen des Magen-Darmtrakts, der Haut oder des zentralen Nervensystems.
Zum Abbau von Histamin werden Tabletten, die das Enzym Diaminooxidase enthalten, angeboten, wie sind sie zu beurteilen?
Bei der Einnahme von DAO-Tabletten ist einiges zu beachten.
Enzympräparate können ihre Wirkung nur im Darm und nur vorbeugend entfalten. Die Einnahme der Diaminoxidase ist wirkungslos gegenüber bereits aufgenommenem Histamin. Es nützt daher wenig, erst dann das Enzym einzunehmen, wenn man nach einer Mahlzeit Symptome verspürt. Deshalb empfiehlt sich die Einnahme ca. 15 bis 30 Minuten vor der Mahlzeit. Enzympräparate sind auch wirkungslos gegen Histamin, das im Körperinneren freigesetzt wird, zum Beispiel durch Allergene, Histaminliberatoren oder unverträgliche Medikamente.
Auch gibt es einige Stoffe, die den Abbau von Histamin hemmen, indem sie das Enzym Diaminoxidase in ihrer Wirkung schwächen. Diese Stoffe nennt man DAO-Blocker. Dazu zählt man Alkohol, schwarzen und grünen Tee, Kakao sowie Energy Drinks, die Theobromin enthalten, das ist ein Bestandteil der Kakaopflanze. Da die Diaminooxidase für den Abbau von Histamin Zeit braucht, ist es wichtig, DAO-Blocker nur in geringen Mengen zu sich zu nehmen, um die Wirkung der Enzymstabletten nicht auszuhebeln. Insbesondere Alkohol ist an dieser Stelle zu nennen, da er gleichzeitig auch die Aufnahme von Histamin in den Darm beschleunigt, sodass dem Enzym auch noch weniger Zeit bleibt, Histamin abzubauen. Auch zahlreiche Medikamente wirken als DAO-Blocker, darunter Schlafmittel, Schmerzmittel, hustenlösende Arzneimittel und bestimmte Medikamente gegen Rheuma.
Das Krankheitsbild Histaminintoleranz (HIT) ist umstritten, woran liegt das Ihrer Meinung nach?
Es gibt keinen Histaminintoleranz-Test! Anhand der bisherigen Datenlage steht eine verlässliche Laborbestimmung im Blut oder Serum zur Diagnose einer Histaminintoleranz nicht zur Verfügung. Die Diagnose kann letztlich erst nach reproduzierbarer klinischer Symptomatik bei der Provokationstestung mit Histamin gesichert werden. Hierzu gibt es noch wenig Datenmaterial. Grundsätzlich sollte die Diagnose Histaminintoleranz erst nach Ausschluss anderer Erkrankungen und relevanter Differentialdiagnosen gestellt werden. Entscheidende Hinweise für eine Histaminunverträglichkeit können das ernährungstherapeutische Anamnesegespräch sowie das Führen eines Ernährungs- und Symptomtagebuch liefern.
Wie sehen Ihre Erfahrungen mit dem Krankheitsbild Histaminintoleranz aus?
Beobachtungen aus der Praxis deuten darauf hin, dass die Beschwerden einer Histaminintoleranz vorwiegend mit einer gestörten Darmbarriere zu tun haben, denn Histamin macht die Darmbarriere durchlässiger. Problematisch ist nicht nur das mit der Nahrung aufgenommene Histamin, sondern auch Substanzen in der Nahrung, die die Mastzellen im Darm dazu anregen, ihr gespeichertes körpereigenes Histamin freizusetzen. Die Symptome werden zwar über das Histamin vermittelt, sie kommen aber nicht über die Nahrungsbestandteile selbst. Die Symptome entstehen aus einer Art körpereigener Folgereaktion.
Sicher gibt es individuell unterschiedliche Empfindlichkeiten auf Histamin und andere biogene Amine und sicher gibt es auch individuelle Unterschiede in der Abbaugeschwindigkeit von Histamin. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass Histamin keine so große Rolle mehr spielt, wenn Betroffene unter ernährungstherapeutischer Anleitung lernen so zu essen und zu trinken, dass ihr Verdauungssystem wieder in Ordnung kommt. So betrachtet könnte die Histaminunverträglichkeit eher die Folge einer anderen Störung im Körper sein als ein eigenständiges Krankheitsbild.
Frau Breunig, herzlichen Dank für dieses Interview!
Allgemeine Empfehlungen für eine histaminarme Ernährung:
- Verwenden Sie ausschließlich histaminarme Lebensmittel.
- Verzichten Sie auf Lebensmittel mit Histaminliberatoren.
- Verzehren Sie Lebensmittel so frisch wie möglich.
- Essen Sie die Nahrung direkt aus dem Kühlschrank, nicht vorher herausnehmen und warm werden lassen.
- Vermeiden Sie das Warmhalten oder Aufwärmen von Fleisch- und Fischspeisen.
- Bereiten Sie Ihre Mahlzeiten aus frischen, unverarbeiteten oder wenig verarbeiteten Rohstoffen zu.
- Lassen Sie eventuelle Reste rasch abkühlen und frieren Sie diese ein. Immer schnell auftauen und sofort verbrauchen.
- Schränken Sie Ihren Alkoholkonsum ein bzw. verzichten Sie ganz auf Alkohol.
- Lebensmittel mit hohem Eiweißgehalt, wie Fleisch oder Fisch, sind besonders anfällig für bakteriellen Verderb. Daher sollten Speisen aus Fleisch oder Fisch nicht wieder aufgewärmt werden.
- Denken Sie daran, dass einmal gebildetes Histamin durch Kochen, Backen oder Einfrieren nicht zerstört wird.
Frau Breunig, herzlichen Dank für dieses Interview!
Wichtiger Hinweis
Unsere Beiträge beinhalten lediglich allgemeine Informationen und Hinweise. Sie dienen nicht der Selbstdiagnose, Selbstbehandlung oder Selbstmedikation und ersetzen nicht den Arztbesuch. Die Beantwortung individueller Fragen durch unsere Experten ist leider nicht möglich.
Autor: S. Jossé/ U. Breunig, www.mein-allergie-portal.com
Lesen Sie auch
-
Histaminintoleranz: Was passiert im Körper? Symptome? Diagnostik?
-
Histaminunverträglichkeit: Das umstrittene Krankheitsbild! Was ist dran?
-
Histaminintoleranz, gibt es das, oder sind es psychische Ursachen?
Weitere Beiträge
News - Histaminintoleranz
- Histaminintoleranz: Hormone, Schwangerschaft, Wechseljahre
- Histaminintoleranz & Glutamat: Gibt es eine Glutamat Allergie?
- Histaminunverträglichkeit: Welche Symptome können auftreten?
- Histamin-Provokationstest: Wie funktioniert diese Diagnose?
- Histaminintoleranz (HIT) – was kann man noch essen?
- Histaminintoleranz: Verjus - Alternative bei Histaminunverträglichkeit
- Histaminintoleranz: Was passiert im Körper? Symptome? Diagnostik?
- Histaminunverträglichkeit: Das umstrittene Krankheitsbild! Was ist dran?
MeinAllergiePortal wird unterstützt von